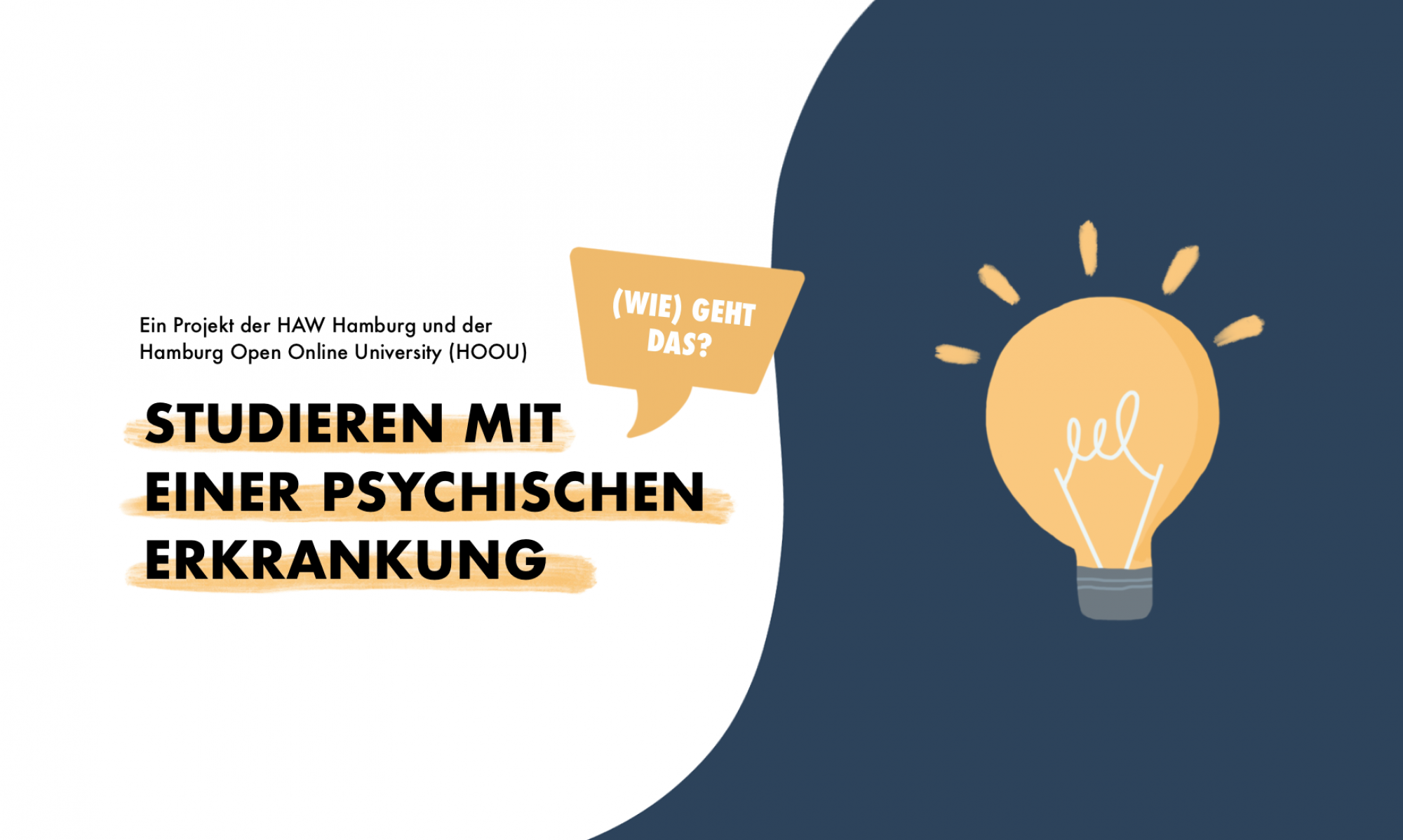Stigmatisierung
Stigmatisierung ist die Ausgrenzung und Abwertung von Menschen oder Gruppen, die nicht den normativen Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Sie findet auf vielen Ebenen statt und ist nicht immer bewusst und beabsichtigt. Stigmatisierung kann zu Diskriminierung führen und umgekehrt.
Obwohl psychische Belastungen und Neurodivergenz so verbreitet sind, werden betroffene Menschen noch immer stigmatisiert. Damit zu leben heißt für Betroffene auch immer, sich mit den Reaktionen ihres Umfelds auseinanderzusetzen. Diese Reaktionen werden geprägt durch kulturell vorherrschende Vorstellungen, Vorurteile und Stereotypen. So hören Menschen mit Depressionen oder Suchterkrankungen oft, ihnen fehle nur die nötige Selbstdisziplin, Menschen mit ADHS seien alle unruhestiftende Zappelphillips, Menschen auf dem Autismus-Spektrum eigenbrötlerische Mathematikgenies. Diese Zuschreibungen sind ungerecht und schmerzhaft.
Stigmatisierung wird darum auch als „zweite Krankheit“ bezeichnet, die zu den Symptomen und Belastungen der eigentlichen Beeinträchtigung dazukommt und manchmal als ebenso belastend empfunden wird. Sie kann nicht nur den Heilungsprozess behindern, sondern oft auch eine frühzeitige Diagnose und Behandlung, weil die Betroffenen sich aus Sorge vor Ausgrenzung zurückziehen und niemandem anvertrauen.
Zusätzlich kann das sogenannte Selbststigma belasten. Wenn Du gelernt hast, Dich dafür zu verurteilen, dass Du psychisch oder neurologisch nicht „funktionierst“ wie es von Dir erwartet wird, kann das Scham, Frust und ein niedriges Selbstwertgefühl zur Folge haben. Wenn Du wegen eines gebrochenen Beins nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen kannst, bist Du wahrscheinlich milder mit Dir, als wenn Du wegen einer depressiven Episode für ein paar Wochen ausfällst.
Diskriminierung
Diskriminierung ist die Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Personen oder Gruppen aufgrund eines negativ bewerteten Merkmals, wie zum Beispiel einer gesundheitlichen Beeinträchtigung.
Zum einen gibt es strukturelle, indirekte Diskriminierung, bei der Prozesse und Systeme in Institutionen oder Organisationen benachteiligend wirken, z.B. die Ablehnung von Bewerber*innen um einen Job/Praktikumsplatz, wenn diese ihre Beeinträchtigung offenlegen. Zum anderen individuelle, direkte Diskriminierung auf zwischenmenschlicher Ebene. Hier wird eine Person aufgrund eines negativ bewerteten Merkmals von anderen ausgegrenzt oder abgewertet, z. B. wird eine Studierende aufgrund ihrer Sprech- oder Verhaltensweise von Mitstudierenden aus Gesprächen ausgeschlossen oder es wird abschätzig mit ihr gesprochen.
Eine der größten Befürchtungen bei der Offenlegung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist Diskriminierung durch andere. Nicht alle Mitstudierenden, Lehrenden und Hochschulmitarbeitenden hatten schon Berührung mit den Themen psychische Erkrankung und Neurodivergenz. Manche haben vielleicht Vorurteile oder wissen nicht, wie sich Dir gegenüber verhalten sollen. Sie können weniger Verständnis zeigen als erhofft, sich wegen Verunsicherung von Dir distanzieren oder Dich anders behandeln, Deine Beeinträchtigung und die Studienanpassungen nicht ernst nehmen. Meistens beeinflussen Vorurteile oder fehlendes Wissen dieses Verhalten. Dann kannst Du versuchen, diese Vorurteile durch Informationen über Deine Beeinträchtigung zu entkräften. Gleichzeitig ist es nicht Deine Aufgabe, kostenlose Bildungsarbeit zu leiten und Du entscheidest, wie sehr Du Dich dahingehend verausgaben kannst und möchtest.
Du hast das Recht, diskriminierungsfrei und chancengleich zu studieren – das regeln die UN-Behindertenrechtskonvention, das Grundgesetz, die Behindertengleichstellungsgesetze von Bund und Ländern, das Hochschulrahmengesetz und die Landeshochschulgesetze. In der Realität gibt es Benachteiligung aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen leider noch immer. Informiere Dich über Deine Rechte und die Möglichkeiten für chancengleiche Teilhabe an Deiner Hochschule. Falls Du unsicher bist, ob Du von Diskriminierung betroffen bist, sammle und überprüfe zunächst alle Fakten und sprich auch mit anderen darüber, wie sie das Vorgefallene einordnen. Wenn nötig, hole Dir professionelle Unterstützung bei einer zuständigen Beratungsstelle.
Hilfreiche Links
Wenn Du unsicher bist, ob und wie Du Deine Beeinträchtigung im Hochschulkontext kommunizieren sollst, haben wir ein paar Entscheidungshilfen zusammengetragen.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Beratung bei Diskriminierung
HAW Hamburg, Vertrauensstelle – Beratung bei Konflikten und Diskriminierung
HAW Hamburg: Antidiskriminierung und Diversity
Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, 2022: Studierendenbefragung zu Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen