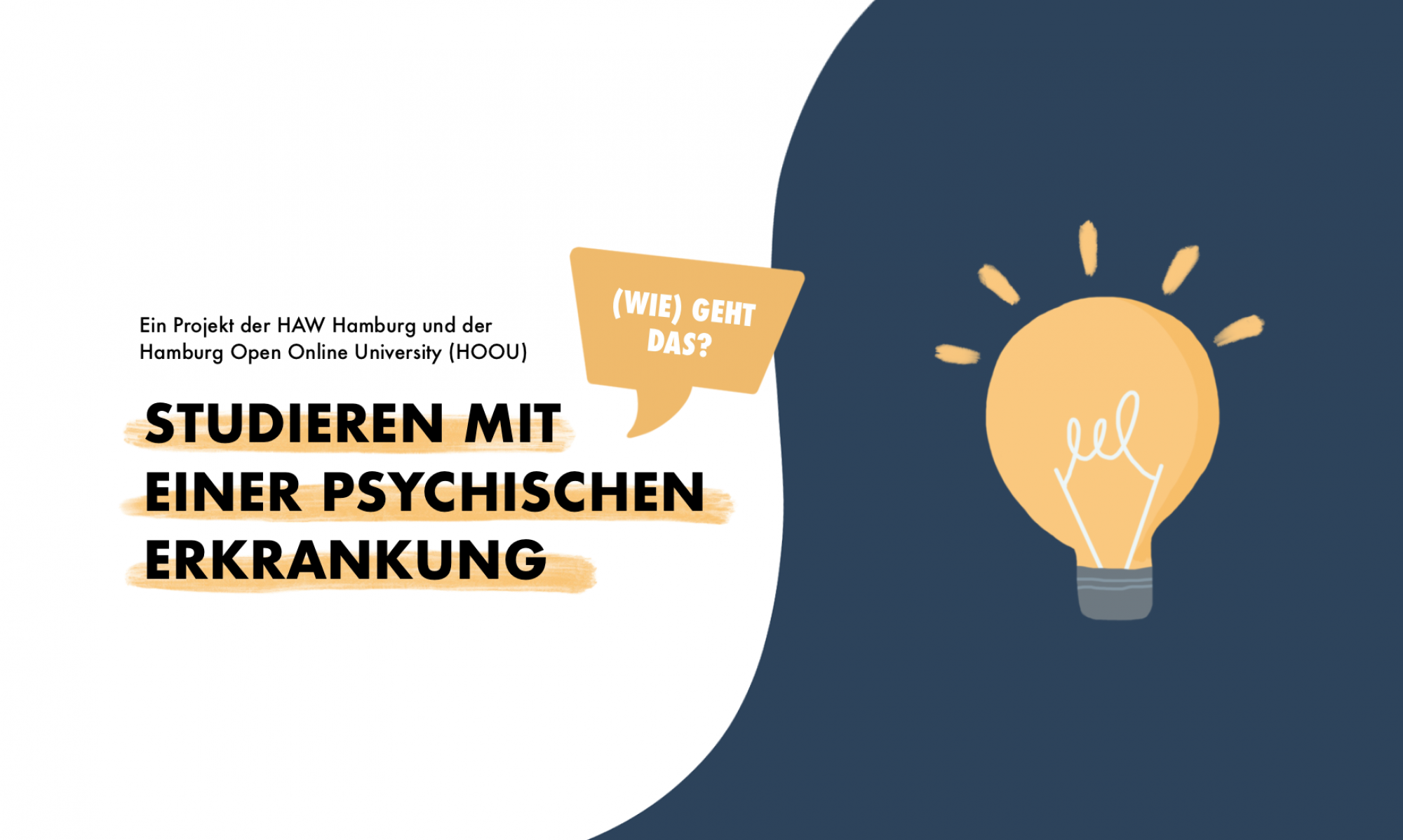Du fragst Dich, ob und wie Du Deine psychische Erkrankung oder Neurodivergenz im Hochschulkontext oder im Praktikum kommunizieren sollst? Bei einer nicht (auf den ersten Blick) sichtbaren Beeinträchtigung steht Dir frei, wie offen Du damit umgehen möchtest. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die immer auch von Deiner aktuellen Lebenssituation abhängt und davon, wie sehr Du im Hochschulalltag belastet bist und was Du durch eine Offenlegung erreichen möchtest.
Vielleicht hast Du Sorge, auf Unverständnis oder Ablehnung zu stoßen, wenn Du mehr von Dir preisgibst. Vielleicht erhoffst Du Dir mehr Verständnis von Mitstudierenden oder möchtest die Möglichkeiten Deiner Hochschule für chancengleiche Teilhabe in Anspruch nehmen.
Das sind verständliche Gedanken und Du musst erst einmal gar nichts – überlege Dir ganz in Ruhe (und wenn Du magst mit Unterstützung), womit Du Dich im Umgang mit Deiner Beeinträchtigung wohl und sicher fühlst. Es ist auch in Ordnung, wenn Du sie lieber für Dich behalten möchtest. Um gewisse Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, etwa Nachteilsausgleiche oder auch BAföG, ist es allerdings nötig, sie offenzulegen.
Wir haben hier Informationen und Anregungen zusammengetragen, die Dich in Deinem Entscheidungsprozess unterstützen sollen.
Inspiriert hat uns das Projekt „Sag ich’s? Chronisch krank im Job“ der Universität zu Köln.
Nimm Dir Zeit für die Vorbereitung
Um eine informierte Entscheidung zu treffen, mache Dir in Ruhe Gedanken, was genau Du auf welche Weise preisgeben und wie Du mit möglichen Reaktionen umgehen möchtest. Du wirst Dich nicht nur einmal entscheiden – der Umgang mit Deiner Beeinträchtigung ist ein Prozess, die Rahmenbedingungen oder Dein gesundheitlicher Zustand können sich verändern. Auch wenn Du Dich entscheidest, nichts zu sagen, ist das eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Informiere Dich im Vorfeld über Deine Rechte.
- WARUM: Was ist der Anlass für das Gespräch? Möchtest Du z.B. Studienanpassungen erreichen oder eine längere Abwesenheit erklären? Was erhoffst Du Dir davon? Geht es einfach um das Zuhören, um emotionale oder praktische Unterstützung? Auch das kannst Du kommunizieren.
- WER: Mit wem möchtest Du sprechen? Wie ist Euer Verhältnis? Du kannst z.B. erstmal mit deiner Lieblingskommilitonin oder einer Person in der psychologischen Beratung reden. Möchtest Du erst mit einer oder gleich mit mehreren Personen sprechen? Kann Dich jemand zu dem Gespräch begleiten? Du kannst z.B. eine*n Kommiliton*in mitnehmen zum Gespräch mit einer Lehrkraft.
- WAS: Wieviel genau Du möchtest Du preisgeben? Wieviel Information ist für Euer Verhältnis relevant? Du kannst z.B. die Diagnose nennen oder nur ganz aktuelle bestimmte Symptome oder Auswirkungen auf Deinen Studienalltag.
- WANN: Wann ist ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch? Du kannst z.B. gleich zu Semesterbeginn, vor Klausuren oder wenn es nicht mehr anders geht darüber sprechen.
- WO: Mit welchem Setting fühlen sich alle Beteiligten wohl? In einer ruhigen Ecke im Café oder im Lehrendenbüro passt es wahrscheinlich besser, als im vollen Flur zwischen zwei Lehrveranstaltungen.
Es kann helfen, Dir einen Satz zurechtzulegen, den Du benutzen kannst, z.B. wenn Dich Mitstudierende beim Wiedereinstieg nach einer Beurlaubung fragen, wo Du letztes Semester warst. Du könntest z.B sagen: „Ich habe aus gesundheitlichen Gründen letztes Semester ausgesetzt, jetzt bin ich wieder dabei.“. Ein Gespräch selbst einleiten könntest Du z.B. mit „Ich würde gerne in Ruhe etwas mit Ihnen besprechen – haben Sie Zeit für ein Gespräch?” oder „In letzter Zeit fühle ich mich nicht so gut. Kann ich mal mit dir darüber reden?“.
Erwarte nicht zu viel von einem ersten Gespräch, gib deinem Gegenüber auch Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Vielleicht gibt es Verständnisfragen oder Ihr könnt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber sprechen. Sorge gut für Dich: achte darauf, Deine persönlichen Grenzen zu wahren und such Dir, wenn nötig, professionelle Unterstützung. Vielleicht informierst Du auch eine befreundete Person oder Deine*n Therapeut*in im Vorfeld, dass das Gespräch stattfinden wird, so könnt Ihr es danach gemeinsam bereden.
Auch der Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen in einem sicheren Rahmen kann helfen, z.B. die Gesprächsangebote von Peer to Peer (der Erfahrungsaustausch ist für Studierende aller Hamburger Hochschulen offen) oder einer Selbsthilfegruppe.
Arbeitsblatt der Uni Köln zum Ausfüllen: Schwierige Gespräche über die gesundheitliche Beeinträchtigung führen
Entscheidungshilfen
Die eigene psychische Erkrankung oder Neurodivergenz zu kommunizieren erfordert Mut, weil immer auch die Möglichkeit besteht, dass die Information nicht wie erhofft aufgenommen wird. Gleichzeitig kann es ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstakzeptanz sein und die Türen für vielerlei Unterstützungsmöglichkeiten öffnen. Für gewisse Studienanpassungen und BAföG ist eine Offenlegung nötig.
Hier sind als Gedankenanstöße ein paar mögliche positive und negative Folgen einer Offenlegung Deiner Beeinträchtigung. Ob diese Sorgen und Hoffnungen begründet sind, wird sich erst zeigen, wenn Du Deine Entscheidung getroffen hast.
Gedanken, die für eine Offenlegung sprechen:
- Du gehst einen aktiven, selbstermächtigten Schritt, den Umgang mit Deiner Beeinträchtigung selbst in die Hand zu nehmen
- Du lernst, Deine eigene Grenzen und Bedürfnisse zu kommunizieren und übst den Umgang mit Deiner Beeinträchtigung für den späteren Berufsalltag
- Du stehst für Deine Rechte ein und kannst Dein Potential besser entfalten. Du kannst Studienanpassungen wie Nachteilsausgleiche oder Teilzeitstudium und Vorteile wie Bafög-Verlängerung oder Verlängerung der studentischen Krankenversicherung in Anspruch nehmen, genauso wie angepasste Rahmenbedingungen im Praktikum.
- Du kannst Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen: bei den Beratungsstellen der Hochschule und bei Lehrenden und Mitstudierenden.
- Du vermeidest das Risiko von negativen Fehlinterpretationen Deines Verhaltens, auf das Unwissende mit Ablehnung oder Distanz reagieren könnten
- Du schaffst die Chance für mehr Verständnis und Verbindung, eine offenere Kommunikation mit Deinen Lehrenden und Mitstudierenden
- Du musst Dich weniger verstellen, die Beeinträchtigung nicht verheimlichen und kannst Dich mehr gesehen fühlen
- Die Offenlegung ermöglicht den Austausch mit anderen Studierenden mit Beeinträchtigung, Du kannst Community finden und andere ermutigen sich zu zeigen, wie sie sind
- Du kannst Diversität sichtbar machen, auf Bedarfe hinweisen und Wege ebnen für andere Betroffene
Gedanken, die gegen eine Offenlegung sprechen
- Die Sorge vor Diskriminierung oder Stigmatisierung bzw. das Risiko von Diskriminierung oder Stigmatisierung auf struktureller oder interpersoneller Ebene
- Eine mögliche Veränderung des Verhältnisses zu Mitstudierenden und Lehrenden (sie könnten Dich aufgrund von Vorurteilen anders behandeln, z.B. Dir weniger zutrauen oder auf Distanz gehen)
- Du möchtest Dein Privat- und Dein Uni-Leben klar trennen
- das Risiko einer Enttäuschung, falls Studienangleichungen nicht bewilligt werden oder Reaktionen nicht wie gehofft ausfallen
- Angst vor Konsequenzen durch ein Abhängigkeitsverhältnis zu Lehrenden und vor schlechterer Bewertung
- Du hast Sorge, Dich allein, anders oder ausgeschlossen zu fühlen oder möchtest keine Sonderbehandlung in Anspruch nehmen
- Du befürchtest, dass eine offiziell erfasste gesundheitliche Beeinträchtigung die Suche nach einem Praktikumsplatz oder späterem Job erschwert
- Deine Diagnose ist frisch und Du möchtest Dich erst einmal schützen und damit zurechtfinden
Hilfreiche Links
Mehr Informationen zu den Themen Stigmatisierung und Diskriminierung
Viele wertvolle Hinweise zur Offenlegung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung im Berufskontext und ein Selbsttest finden sich auf der Webseite des Projekts Sag ichs? der Universität zu Köln.
Folge der Podcast-Reihe „Studieren mit Beeinträchtigung und chronischer Erkrankung“ der Uni Giessen: „Sag Ich’s?“ – Interview mit Dr. Jana Bauer vom Projekt Sag Ich’s? (Transkript verfügbar)
Folge der Podcast-Reihe „Chronisch krank an der Uni Trier – Was das Modulhandbuch nicht hergibt“: Soll ich sagen, dass ich eine Erkrankung habe? (Triggerwarnung: kurze Erwähnung von Suizidgedanken)
In unseren Erfahrungsberichten beschreiben Studierende den Umgang mit ihrer Beeinträchtigung.